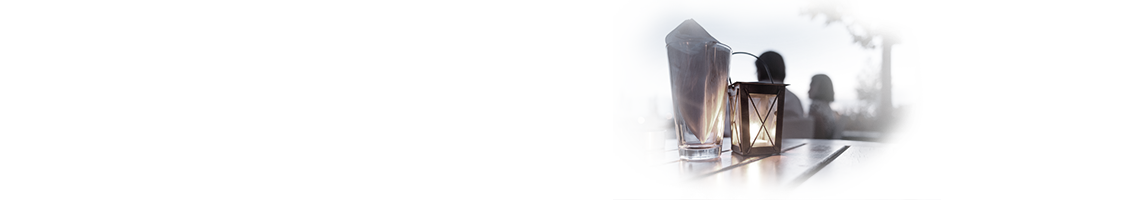In einem von 7Mind erschienen Beitrag zu diesem Thema werden viele Facetten der Kommunikation in unserem täglichen Leben beleuchtet. Sei es in der Familie, im Sport, im Ehrenamt oder im beruflichen Umfeld. Wir übernehmen alle in gewisser Weise eine Führungsfunktion. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, spielt dabei eine entscheidende Rolle, besonders in schwierigen Situationen. Autoritäres Verhalten muss gelegentlich mal sein und mag kurzfristig Wirkung zeigen, doch langfristig ist eine erfolgreiche Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg.
Achtsamkeit als Weg zur gemeinsamen Lösung
Unabhängig davon, ob wir eine Familie leiten, ein Unternehmen führen oder Teams organisieren, sind Konflikte unvermeidlich. Doch wie gehen wir damit um? Die Antwort liegt in der Achtsamkeit – einem Instrument, das uns hilft, uns für andere zu öffnen, starke Bindungen zu knüpfen und Probleme konstruktiv zu lösen.
In schwierigen Situationen ist es wichtig:
- Achtsam Zuhören: Die andere Person ausreden lassen, aktiv hinhören und Ablenkungen wie das Smartphone beiseitelegen.
- Einfühlen: Augenkontakt halten, Empathie zeigen und sich in die Perspektive der anderen Person versetzen.
- Raum schaffen zwischen Reiz und Reaktion: Ein bis zwei tiefe Atemzüge nehmen, bevor man auf Gesagtes reagiert.
- Gedankenkarussell stoppen: Eigene Interpretationen erkennen und sachliche Perspektive bewahren.
- Innere und äußere Impulse einordnen: Gemeinsam Lösungen erarbeiten, das eigene Verhalten reflektieren und ein gemeinsames Ziel definieren.
Achtsamkeitstraining und Meditation fördern nicht nur die Kontrolle über emotionale Prozesse, sondern schärfen auch die Sensibilität für die eigenen Bedürfnisse und die der anderen – eine Schlüsselkompetenz nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext.
Gewaltfreie Kommunikation als Grundlage für gemeinsame Lösungen
Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Dr. Marshall B. Rosenberg ist eine bewährte Methode, um bei Meinungsverschiedenheiten schneller zu einer gemeinsamen Lösung zu gelangen. Die GFK basiert auf Klarheit, Empathie und dem Aufbau starker zwischenmenschlicher Beziehungen.
In vier Schritten zur richtigen Balance zwischen konstruktiver Kritik und Zuhören:
- Beobachtungen äußern und Fakten liefern: Anstatt zu bewerten, klare Beobachtungen mitteilen.
- Gefühle aussprechen statt Schuldzuweisungen: Offen über eigene Emotionen sprechen, ohne die andere Person zu beschuldigen.
- Bedürfnisse erläutern, statt starre Positionen einzunehmen: Offenlegen, welche Bedürfnisse wichtig sind, ohne dabei personalisiert zu agieren.
- Bitten formulieren statt Forderungen: Kooperative Bitten um gemeinsame Lösungen aussprechen.
GFK-Training ermöglicht die Entspannung von konfliktgeladenen Situationen und fördert eine positive Unternehmenskultur. Eine Studie des “Institute for Mindful Leadership” hat zudem gezeigt, dass Mitarbeiter von achtsamen Führungskräften nicht nur zufriedener, sondern auch kreativer sind.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass erfolgreiche Kommunikation nicht nur das Betriebsklima verbessert, sondern auch auf das gemeinsame Ergebnis einzahlt. Die positiven Wirkungen von Achtsamkeit und Gewaltfreier Kommunikation lassen sich auf alle Formen des Führens bis hin zur Lebensführung ausdehnen.
Du möchtest gerne mehr zu diesem Thema wissen und achtsamer in deiner Kommunikation sein? Dann schreibe uns gerne eine Mail an die team@mindful-business-life.de. Wir freuen uns auf deine Anfrage.